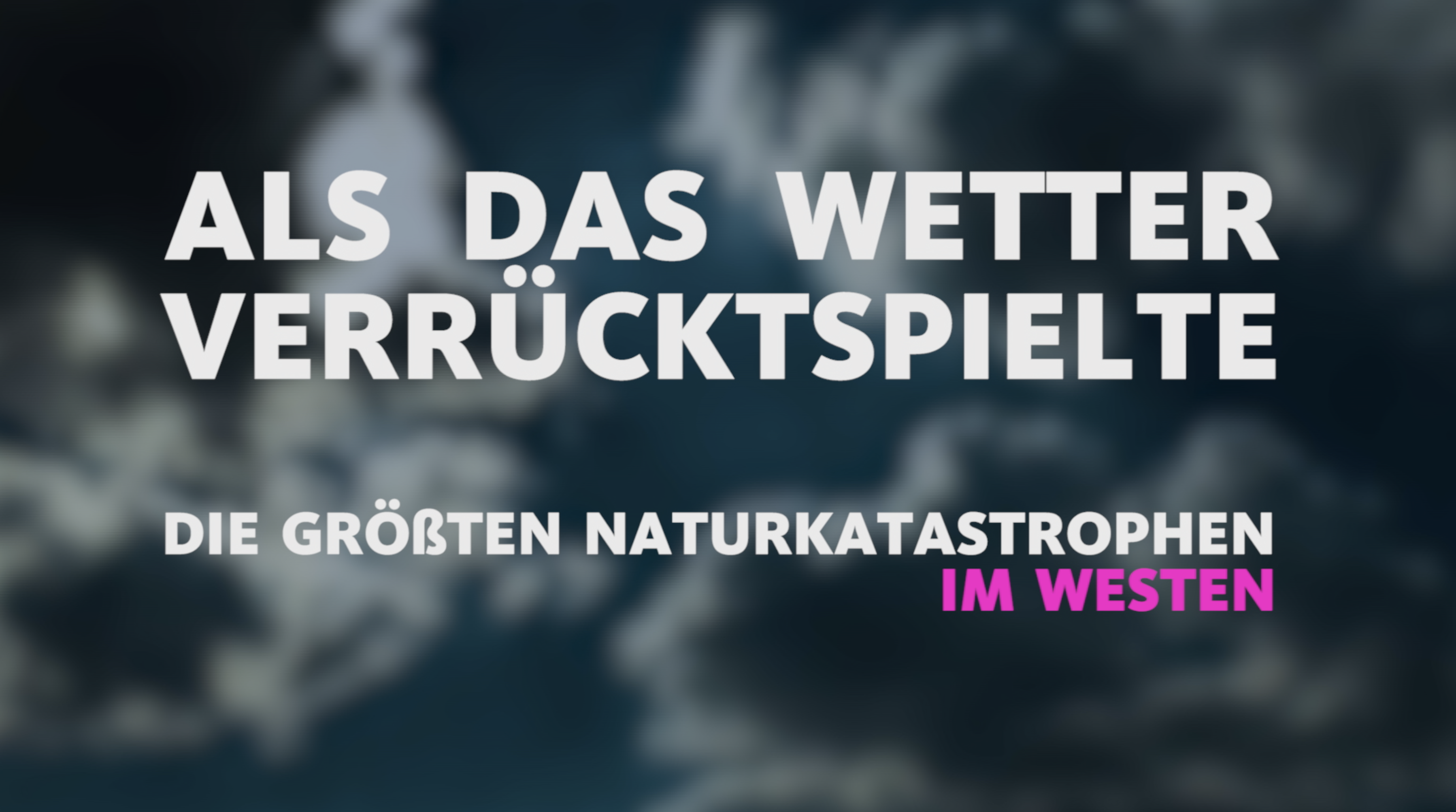Autor: Lothar Schröder, Kamera: Dierk Fechner, Florian Brückner, Redaktion: Adrian Lehnigk
Es wird in Zukunft immer mehr extreme Unwetter geben. Dessen ist sich der ARD-Meteorologe Sven Plöger sicher. Häufigere Starkregen, die die Städte überfluten und Keller volllaufen lassen. Heftigere Orkane, die Dächer abdecken und Bäume entwurzeln. Heiße und trockene Dürresommer, die der Landwirtschaft zu schaffen machen.
Allein im Jahr 2018 war alles dabei – Orkan Friederike, Rheinhochwasser von Königswinter bis Emmerich, Regen-Überschwemmungen in Wuppertal, zerstörerischer Tornado in Viersen und sommerliche Dürre im ganzen Land. So konzentriert in einem Jahr hat es das noch nicht gegeben, obwohl NRW oft schon stärkere Unwetter mit schlimmeren Folgen erlebt hat.
Mit Analysen und Bewertungen von Sven Plöger blickt „Als das Wetter verrücktspielte“ auf die heftigsten Unwetter der letzten 25 Jahre zurück.
Der Wintersturm Kyrill, der am 18. Januar 2007 mit über 200 km/h über das Land raste und dabei allein in NRW nicht weniger als 25 Millionen Bäume entwurzelte, die meisten davon im Sauerland und Siegerland. Kyrill veränderte Landschaften, kostete vielen Menschen die Existenz und manche sogar das Leben.
Das Erdbeben, mit dem Epizentrum in der Region Aachen, hatte niemand erwartet. Das letzte folgenreiche Erdbeben in NRW war schließlich 236 Jahre her. Aber als am 13. April 1992 die Erde wackelte, wurden nicht nur viele Häuser in Heinsberg zerstört, sondern auch Teile des Kölner Doms, als Kreuzblumen zu Boden stürzten.
Zwei Jahre später flogen an einem heißen Sommertag faustgroße Hagelkörner auf die Stadt herab. Sie durchlöcherten Gewächshäuser, Fenster, Glasdächer und zerbeulten tausende von Autos. In einem 18 Meter hohen Fenster des Kölner Doms zählte man 40 Löcher.
In Münster waren es zwanzig Jahre später „nur“ Regentropfen, dafür eine unglaubliche Menge. Teilweise fielen 290 Liter auf den Quadratmeter und überfluteten in kurzer Zeit das gesamte Stadtgebiet. Das hatte es noch nie gegeben. Von drei Uhr nachmittags bis Mitternacht goss es wie aus Kübeln, 40 Millionen Kubikmeter Regenwasser. Zwei Menschen ertranken im Keller bzw. im Auto.
Der Jahrhundertsommer 2003 war genau das Gegenteil und das erste Wetter-Ereignis, das Wissenschaftler in direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel setzten. Mit 70.000 Toten war es eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte Europas. Von Mai bis September blieb es heißer und trockener als jemals zuvor.
Die Dauer und Intensität der Temperaturrekorde, machte das Hoch „Michaela“ zu einem meteorologischen Phänomen.
Auch das Jahresende hat mit dem ersten Schnee oft heftige Unwetter zu bieten. Als sich am 25. November 2005 eine Milliarde Tonnen klebriger Neuschnee über das Münsterland und auch auf die Stromleitungen legten, brach das Chaos aus. Unter der Last des Schnees brachen 82 Masten zusammen, was bei 250.000 Menschen zu Stromausfällen führte. Ochtrup im nördlichen Münsterland, bibberte fast eine Woche ohne Heizung und Strom.
In dieser Krise wurde den Menschen wie selten zuvor die Abhängigkeit vom Strom deutlich und sie mussten die Grenzen des Fortschritts erkennen.
Es gibt Anlässe, da kann man kein Unwetter gebrauchen. Die Weihnachtszeit 1993 wurde den Rheinanliegern durch das heftigste Hochwasser seit 1926 vermasselt. Schon zwei Tage vor Heilig Abend standen Häuser in der Kölner Altstadt bis zur Decke unter Wasser. In Bonn war der Ortsteil Beuel sogar 400 Meter landeinwärts geflutet. Die zehn Meter hohen Schutzwände konnten den Strom nicht aufhalten, der Pegel stieg auf 10,70m. Viele Menschen mussten die festlichen Tage bei Kerzenlicht ohne Heizung und Strom verbringen, lernten in der Krise aber manche fast vergessene Werte des Miteinanders wieder zu schätzen.