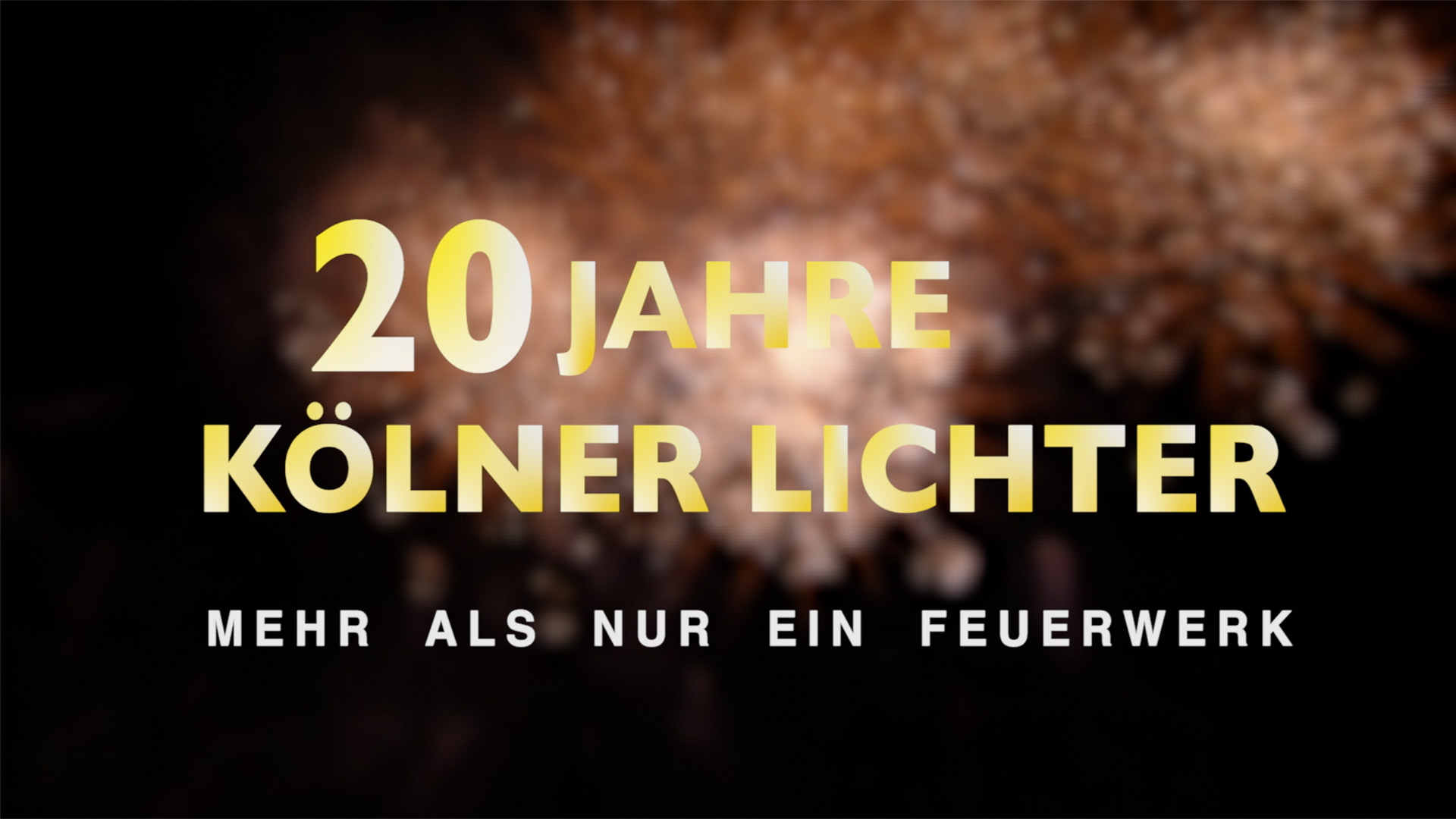Der Jahrhundertsommer 2003
Sendetermin: 27.7.2018
Autor: Lothar Schröder, Kamera: Florian Brückner, Dierk Fechner, Redaktion: Adrian Lehnigk
Bereits im Juni ging es los. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1901 hatte es keinen heißeren Juni gegeben. Bis zu vier Grad über dem Monatsdurchschnitt lagen die Temperaturen in Deutschland. Die Sonne schien mit rund 260 Stunden rund 40 Prozent länger als sonst. Deutschland schwitzte, ganz Europa schwitzte – und die Menschen überschlugen sich mit Superlativen zu dem Hochdruckgebiet „Michaela“: Hitzesommer! Rekordsommer! Jahrhundertsommer! Was dran ist kann der Meteorologe Sven Plöger einordnen.
Zunächst freuten sich die Menschen, Hochbetrieb in Schwimmbädern und Biergärten. Doch der Alltag ging weiter und an eine derart intensive und lange Hitzeperiode war niemand gewohnt. Warme Nächte sorgten für Schlafentzug und darauf folgende Gereiztheit, Aggressionen und Bluthochdruck wurden verstärkt. Der damals junge Streifenpolizist Jan Schabacker hat in Duisburg einschlägige Erfahrungen gemacht. Er hatte ständig mit Ausrastern zu tun.
Die Sterblichkeit v.a. der älteren Menschen stieg täglich. In Deutschland starben in diesem Sommer 3.500 Alte und Kranke, oft an Lungenversagen. Wer sich schützen wollte, musste schnell sein. Ventilatoren waren schnell ausverkauft, Getränkeläger bald leer, weil die Kundschaft die Pfandflaschen nicht zügig zurück brachte.
Wassernotstand in NRW! In Münster installierte der Zoodirektor für die Besucher einen künstlichen Wasserfall. Die Menschen suchten Abkühlung überall, auch im Rhein. In Köln und Düsseldorf entstanden große Strände, denn der Fluss wurde immer schmaler – eine trügerische Sicherheit. Die Schwimmer kamen zu nahe an die Schiffe, Wellen und Verwirbelungen zogen sie unter Wasser. 15 Menschen starben.
Binnenschiffer hatten kaum noch Wasser unter dem Kiel und konnten nur noch ein Drittel der Ladung transportieren. In Düsseldorf maß der Rheinpegel zeitweise nur noch 74 Zentimeter. Täglich war Josef Zimmermann mit seiner Quirinus auf dem Rhein unterwegs und lieferte mit seiner Peilanlage neueste Zahlen des Niedrigwassers. Für Cäptn Klaus-Erich Reinhard das Geschäft seines Lebens. Zwar musste er mit seiner Aqua Verde hochkonzentriert fahren, um nicht aufzusetzen, aber mit seinem nur 84 Meter langen Frachter durfte er immerhin auslaufen. Zwar konnte er nicht viel laden, fuhr dafür öfter und bekam noch Zuschläge – ein unvergessener Sommer.
Die Aale hatten nicht genug Sauerstoff – 15.000 verendeten mit der Rotmaulseuche im Rhein. Rudi Hell aus Kalkar, heute mit fast 80 Jahren der letzte Rheinfischer, ging heute wie damals mit seinem 20 Meter langen Schocker zum Aal fischen und konnte den Anblick der vielen toten Tiere nicht fassen.
Weitere 500-600 Fische erstickten in den Nebenarmen des Rheins. Im Sauerland traf es die Forellen in den Zuchtteichen.
Landwirtschaft sahen ihre Existenz bedroht: Weizen und Roggen hatten hohe Einbußen. 15%, bei den Zuckerrüben sogar 20% weniger Ernte – das hat Johannes Brünker aus Swistal bis heute nicht vergessen. Das große Leiden: Die Wurzeln verdorrten, Maiskolben schrumpften, Äpfel bekamen braune Flecken, Kartoffeln trieben zu früh, die Sonnenblumen wendeten sich braun und schlaff von der Sonne ab. Die Dürre, die im Osten Deutschlands zur Versteppung führte, konnten die guten Böden im Rheinland überleben.
Die Förster hatten Angst um die Wälder: In Attendorn wurde der Wald für Spaziergänger gesperrt, denn durch die verheerende Waldbrände in Portugal und Spanien war man gewarnt. Am Niederrhein gab es die ersten Kontrollflüge, später auch in der Eifel, im Bergischen und Ostwestfalen. Hobbyflieger stellten sich für Aufklärungsflüge zur Verfügung, Schüler, wie der damals 17jährige Simon Heil bezogen Posten auf Brandwachtürmen(Möncdhengladbach), um frühzeitig Rauchsäulen zu melden. Gebrannt hat es dann in Nettetal , da fackelten 10.000 qm Wald ab. Hans Moors war damals Einsatzleiter, koordinierte 100 Feuerwehrleute aus Deutschland und Holland. Ihm war schnell klar, dass hier Brandstifter am Werk waren.
Die Bahn wurde zur rollenden Großsauna, die Klimaanlagen machten bei der Hitze schlapp. Und die Gleise barsten und bogen in der gnadenlosen Sonne.
Sommer 2003: In diesem Sommer gab es 30 Sonnentage mehr als üblich. Die Temperaturen lagen im Schnitt 3-4 Grad höher und kletterten am 13. August auf den Rekordstand von 40,1 Grad. Gemessen von Herrmann-Josef Dahmen in seiner privaten Euskirchener Wetterstation.
In Mettmann fiel wegen Überhitzung eine Ampel aus. Die Panne dauerte zwei Stunden. Der Techniker konnte den Schaltkasten nicht anfassen – zu heiß.
Bis heute gilt der Sommer 2003 als eine der schwersten Naturkatastrophen Europas der vergangenen hundert Jahre. Der extrem nasse Sommer 2002 hatte noch katastrophale Überschwemmungen gebracht. Ein Jahr später erlebten die Menschen genau das Gegenteil.